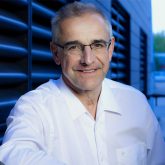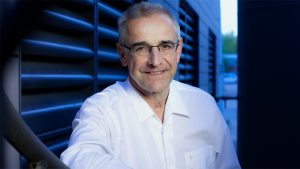Mediale Dorf-Bilder der Gegenwart (zuerst erschienen in der Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie)
von Gisbert Strotdrees

Klischee oder reales Abbild? Der ländliche Raum in den Medien. / Foto: muensterland/flickr (CC BY-SA 2.0)
Dorfalltag und Landleben bilden seit jeher ein Thema journalistischer Berichterstattung. Es schlägt sich keineswegs nur in den lokalen Medien, sondern auch in Beiträgen überregionaler Tages- und Wochenzeitungen oder Rundfunksender nieder. Gerade diese überregionale Berichterstattung stellt einen wichtigen Beitrag öffentlicher Kommunikation dar, auch im Zeitalter digitaler Medien und Netzwerke. Denn in den überregionalen Tages- und Wochenzeitungen – ob gedruckt oder online – sowie im Rundfunk werden die zentralen Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur zur Sprache gebracht und verhandelt, darunter auch Fragen des ländlichen Raumes. Umgekehrt können gerade überregional verbreitete Berichte auf die jeweiligen Akteure auf Dorfebene bzw. auf die dargestellte Umgebung zurückwirken. Die journalistischen Beiträge können ermuntern und anspornen, sie können Abwehrhaltungen auslösen und in laufende Debatten eingreifen – vor allem aber können sie Bilder prägen, etwa vom Dorf XY als Idylle oder von der Region Z als „Problemzone“.
Welche Bilder aber wurden und werden da vermittelt? Wie ist es überhaupt bestellt um das mediale Interesse am Landleben? Gibt es so etwas wie Konjunkturen des Medieninteresses am Ländlichen – und das auch jenseits bewegender Themen wie demonstrierender Bauern, Gebäude-Leerstand oder Landarztmangel? Entwickeln überregionale Medien ein journalistisches Verständnis für den „nicht leicht zu erschließenden komplexen Kosmos des Dorfes“ (Henkel 2016:252), für seine vom urban-bürgerlichen Raum abweichenden Hierarchien, Kommunikationsmuster, Lebenswelten, mentale Einstellungen und besonderen Regeln des Miteinanders – mithin eines Kosmos, den es hier unter dem Begriff der „Dörflichkeit“ zu erkunden gilt?
Dieser Fragenkomplex soll im Folgenden mit Blick vor allem auf die überregionalen Tages- und Wochenzeitungen beleuchtet werden. Erstaunlicherweise gibt es zu dieser Fragestellung so gut wie keine Forschungsliteratur. Die letzte Studie, die sich den Wechselwirkungen zwischen ländlichem Raum und (Lokal-) Journalismus gewidmet hat, ist vor einem Vierteljahrhundert erschienen (Herrmann 1993). Die Autorin, Redaktionsleiterin des Coburger Tagblatts, hat darin die Produktionsbedingungen einer Lokalredaktion im ländlichen Raum untersucht. Der „Eigen-Sinn“ ländlicher Lebenswelten, so ihr Befund, bleibe Wissenschaftlern, Planern und Journalisten oftmals verborgen, weil sie „in den Seilen des Modernisierungstheorems“ hingen und die Besonderheiten der ländlichen Lebenswelt verkennen. (Herrmann 1993: 36, mit Verweis auf die frühere Dorf-Studie von Utz Jeggle und Albert Ilien 1978).

Laut Dorfforscher Gerhard Henkel berichten lokale und regionale Zeitungen (wie die hier gedruckte Nordwest-Zeitung) „ausführlich und verständnisvoll“ über den ländlichen Raum. Anders sieht es bei den überregionalen Medien aus. / Foto: WE-Druck GmbH & Co. KG, CC BY-SA 4.0
Der Geograph und Dorfforscher Gerhard Henkel hat sich in seiner jüngsten Streitschrift ebenfalls mit der Rolle der Medien befasst (Henkel 2016: 247-253). Sein Fazit: Lokale und regionale Zeitungen berichteten „ausführlich und verständnisvoll von den mannigfachen, kommunalen und bürgerschaftlichen Problemen und Aktivitäten auf dem Land“. Doch je weiter die Medien vom Land entfernt seien, desto mehr steige ihre Ignoranz und Arroganz gegenüber Dörfern und Kleinstädten und ihren Bewohnern, so der generelle Vorwurf Henkels. Die Berichterstattung der überregionalen Tageszeitungen und der Rundfunkanstalten erfasse den ländlichen Raum „mit seiner ökonomischen, kulturellen und sozialen Vielfalt und Wertigkeit“ nur selten, so sein Befund. Das Land komme „häufig schlecht weg, negative Berichte überwiegen“ (ebd.: 248).
Statistische Auswertungen freilich, die diese These unterstützen, bleibt Henkel schuldig. Trennscharfe Daten, die die Häufigkeit und den Umfang der Berichterstattung überregionaler Tageszeitungen und Rundfunkanstalten zum Thema „Land / Dorf / Dörflichkeit“ belegen könnten, sind nur mit hohem Aufwand zu ermitteln. Einen Eindruck immerhin vermittelt die Genios-Datenbank, die einen großen Teil der deutschsprachigen Presselandschaft abbildet: von A wie den regionalen „Aachener Nachrichten“ bis Z wie die überregionale Wochenzeitung „Die Zeit“ (Hamburg).
Für die Frage nach der medialen Präsenz wurde die Genios-Datenbank nach den Stichworten „Dorf“, „ländlich*“, „Landleben“ und Dorfleben“ für die Jahre 1990, 1995 sowie für den Zeitraum 2000 bis 2017 befragt, die Datenbanksuche dabei auf die überregionalen Tages- und Wochenzeitungen eingegrenzt. Erfasst ist damit die Berichterstattung unter anderem von Frankfurter Allgemeiner Zeitung, Focus, Handelsblatt, Spiegel, Süddeutscher Zeitung und Die Zeit.
Das Ergebnis: In absoluten Zahlen betrachtet, zeigt sich eine auffallende steigende Kurve bei der Verwendung des Substantivs „Dorf“, und des Adjektivs „ländlich“. Ähnliches gilt, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau, für die Substantive „Dorfleben“ und „Landleben“.
Vor voreiligen Schlüssen sei allerdings gewarnt, denn: Im Abfrage-Zeitraum ist auch die Datengrundlage der Genios-Datenbank expandiert. Genaue Angaben bietet der Betreiber der Datenbank nicht an. Einen Anhaltspunkt liefert immerhin die vergleichende jährliche Abfrage der fünf, im Deutschen besonders häufig benutzten Wörter „der“, „die“, „das“ „und“ sowie „in“. Setzt man sie ins Verhältnis zu den gesuchten Wörtern „Dorf“, „ländlich“, „Dorfleben“ und „Landleben“, flachen die Kurven ab – die steigende Tendenz für „Dorf“ und „ländlich“ ist aber auch aus dieser Sicht eindeutig.
Linguistisch exakt ist dieses Vorgehen sicherlich nicht, und der Wortabfrage müsste eine inhaltliche Analyse der jeweiligen Artikel folgen, die außerdem ins Verhältnis zu den jeweils verbreiteten Auflagen gesetzt werden müssten. Dennoch bieten die absoluten und relativen Wortkurven einen passablen Eindruck von den Konjunkturen ländlicher bzw. dörflicher Themen in der überregionalen deutschsprachigen Presselandschaft.
Das Wort „Dörflichkeit“ taucht in der gesamten deutschsprachigen Presse seit 2000 ganze 101 Mal auf. Der Duden kennt das Stichwort gar nicht, im „Deutschen Wörterbuch“ der Brüder Grimm ist es ebenfalls nicht zu finden. Die Suchmaschine Google hingegen kennt das Wort und verlinkt einen ihrer ersten Treffer auf einen Beitrag mit dem Titel „Hinter Berliner Zäunen“, veröffentlicht im Mai 2017 in der Wochenzeitung „Die Zeit“. Der Journalist Kai Biermann schreibt darin über Altglienicke, den Ort seiner Kindheit, unter anderem:
„Eingeklemmt zwischen Rudow, Bohnsdorf und dem Flughafen Schönefeld geht die Großstadt dort in die zersiedelte Dörflichkeit Deutschlands über. Die Häuser haben kleine Gärten drumherum, manche einen Swimmingpool. Dazu geschnittene Hecken, geputzte Autos. (…) Wer will, kann in Altglienicke eine Idylle sehen. Schlafende Straßen, sogar ein paar Pferdekoppeln. Feldlärchen tillern, Stare knurren, Bienen taumeln über die Wiese und saufen die Blüten leer und auf dem Plumpengraben, der wirklich so heißt, schaukeln Enten in der Grütze. Kleinstadtruhe am Großstadtrand. Die Leute reden vom Dorf, wenn sie Altglienicke meinen. Die Hauptstadt scheint weit weg. Schon immer war das friedliche Bild jedoch nur eine Fassade, war der Ort zerrissen, waren die Unterschiede groß: Arme gegen Reiche, Alte gegen Neue, Laubenpieper gegen Hausbesitzer, Linke gegen Rechte. Mauern und Zäune überall.“ (Biermann 2017).
Folgt man diesem Autor, dann bedeutet Dörflichkeit so viel wie: Einfamilienhäuser, kleine Gärten, geschnittene Hecken, blitzblanke Autos und ein kräftiger Schuss Natur. Dörflichkeit ist aus seiner Sicht aber auch Fassade und Fiktion – es gibt sie nicht mehr, zumindest nicht in Alt-Glienicke, das irgendwann im Schatten der Großstadt verloren gegangen ist.

Willkommen in Altglienicke: Einfamilienhäuser, kleine Gärten, geschnittene Hecken, blitzblanke Autos. Der Inbegriff von „Dörflichkeit“? / Foto: Fridolin freudenfett CC BY-SA 3.0
Völlig anders sieht es in der „Landlust-Welt“ aus. Das Hochglanz-Magazin, in den Jahren 2004/5 im Landwirtschaftsverlag in Münster entwickelt, hat von Beginn an beabsichtigt, „die schönsten Seiten des Landlebens“ zu präsentieren. Es war ursprünglich als Magazin für Frauen auf dem Land konzipiert und verfolgte, wie dem Editorial des ersten Heftes von 2005 zu entnehmen ist, den folgenden Ansatz: „Alles, was das Landleben liebenswert macht, möchten wir Ihnen in dieser Zeitschrift zeigen. Einfach und natürlich, wahrhaftig und wertorientiert will sich, Landlust’ präsentieren.“ Angesprochen werden sollten Leserinnen und Leser, die „auf dem Land leben“, die „ländliche Lebensweisen schätzen“ oder „auf dem Land Wurzeln schlagen möchten“. (Frieling-Huchzermeyer 2005: 3)
Der Mix aus Themen rund um Garten, Küche, Natur, „Ländlichem Wohnen“, verfasst von versierten Fachautorinnen und -autoren, illustriert mit großzügigen Fotostrecken und graphisch aufwändig gestaltet, erwies sich als überraschend erfolgreich. Dörfer allerdings sind im Magazin „Landlust“ eher selten portraitiert – und wenn, dann allenfalls im Rahmen von Reisereportagen. Wer sich für den bundesdeutschen Dorfalltag interessiert, insbesondere für wirtschaftliche und/oder soziale Strukturschwächen, für Problemlagen, Konflikte sowie für pragmatische Ansätze zur Lösung, geht in der „Landlust“ leer aus. Ähnliches gilt für die Landwirtschaft: Auch sie fehlt nahezu vollständig. Beiträge etwa zu Pflanzenbau, Tierhaltung oder Landtechnik, zu Konfliktlagen zwischen Ökonomie und Ökologie oder auch Portraits einzelner landwirtschaftlicher Betriebe sind im Magazin nicht zu finden.

Das echte Landleben kommt im boomenden Magazin-Segment von Zeitschriften wie „Landlust“ kaum vor. / Foto: United Soybean Board / Flickr CC BY 2.0
Dennoch – oder gerade deswegen? – hat diese Zeitschrift enormen Erfolg, zumindest was seine Auflagen- und Reichweitenentwicklung angeht. Darüber ist viel diskutiert worden, in der Wissenschaft und nicht zuletzt in der Medienlandschaft. „Medias@res“, das Medienmagazin des Deutschlandfunks, hat sich im Oktober 2017 mit der „Erfolgszeitschrift“ befasst und sein Porträt unter die Überschrift gestellt: „Erholung, Harmonie und Heimat“ (Hoolt 2017). Das Magazin Landlust, so heißt es da, zelebriere das ländliche Idyll und treffe damit „ein Bedürfnis der Zeit“, erläuterte Bernd Blöbaum, Professor für Medientheorie und Medienpraxis an der Universität Münster, einen von zwei entscheidenden Gründen für den Erfolg. Den zweiten Grund sieht er in der fachjournalistischen Professionalität, der „opulenten Machart, in der die Landlust das Publikum erreicht“, den „ tollen Fotostrecken“ und „gut gemachten Inhalten“.
Der Erfolg des Magazins löste – mit einer Verzögerung von zwei, drei Jahren – eine bundesweite Gründungswelle von Nachahmer-Magazinen aus: „Liebes Land“, Landliebe“, „Schönes Land“, „Landgenuss“, „Landkind“, „Landapotheke“ und so weiter. In Deutschland entstand „quasi aus dem Nichts“ (Winterbauer 2011) eine vollständig neue Zeitschriftensparte, die bereits fünf Jahre nach dem Start von „Landlust“ eine Gesamtauflage von „mindestens 1,5 Mio. hart verkaufter Hefte“ (ebenda) erreicht hat.
Diese Welle löste die Entwicklung neuer und überaus erfolgreicher Formate auch im Fernsehen an. Hier genannt seien nur die Sendereihen „Land & Lecker“ (seit 2009 im Westdeutschen Rundfunk), „Von und zu lecker“ (seit 2010 im Westdeutschen Rundfunk), „Landfrauenküche“. (seit 2009 im Bayrischen Rundfunk), „Landlust TV“ (seit 2011 im Norddeutschen Rundfunk), „Schönes Landleben“ mit „Hofgeschichten aus dem Norden“ (ebenfalls seit 2011 im NDR). Eine der Sendungen dieser zuletzt genannten Reihe, erstmals im Oktober 2013 ausgestrahlt, wurde mit einem Pressetext angekündigt, der hier beispielhaft zitiert sei:
„,Schönes Landleben’ auf dem Hof Wörme am Rande der Lüneburger Heide mit einer Traumhochzeit: Die Nichte von Hubertus von Hörsten wünschte sich, ihren schönsten Tag auf Hof Wörme feiern zu können. Alle sind bei den Vorbereitungen eingespannt, über 100 Gäste wollen bewirtet werden. Hubertus von Hörsten plant und koordiniert für seine Nichte Sylvia – alles neben der täglichen Arbeit. Hof Wörme ist einer der ältesten Biohöfe Norddeutschlands: seit 1947 wird hier ohne Mineraldünger und chemischen Pflanzenschutz Gemüse, Getreide und Obst angebaut. In dieser Tradition wird der Betrieb auch heute noch geführt. Dieser Hof ist etwas ganz Besonderes: Pfaue stolzieren dort im prächtigen Federgewand, Japanerinnen kneten Brotteig nach norddeutschem Rezept, Pferde ziehen vorsintflutliches Arbeitsgerät. Und die Töchter des Hofes heiraten in roten Gummistiefeln und mit selbst gebundenen Blumenkränzen im Haar.“ (NDR 2013)

Das medial vermittelte Landbild transportiert traditionelle Gesellschaftsmuster aus dem 19. Jahrhundert wie auf diesem Bild.
Dieser PR-Text ruft alle Attribute auf, die dem Leben „auf dem Lande“ traditionell zugeschrieben worden sind. In wenigen Zeilen tauchen auf: der Hofbesitzer als „Pater familias“, noch dazu mit adlig klingendem Namen, seine Uneigennützigkeit und sein Familiensinn, das Handeln in familiärer Gemeinschaft, das vormoderne, um nicht zu sagen: anti-moderne Wirtschaften in Feld („vorsintflutliches Arbeitsgerät“) und Haus („kneten Brotteig“) – und die klare Rollenverteilung der Geschlechter: der Mann organisiert und agiert, die Frauen hingegen kneten Brotteig oder heiraten, wenn auch „in roten Gummistiefeln“. Anders gesagt: Hier werden in wenigen Sätzen die traditionellen Muster heraufbeschworen, die seit dem 19. Jahrhundert mit dem Land verbunden und mit Begriffen umschrieben werden wie: Gemeinschaft, Tradition, Zusammenhalt, eine Überlappung des privaten und des öffentlichen Bereichs. (vgl. Tönnies 1887; Wunder 1986: 8-10)
Tristesse und Randfrust abseits der Großstadt auf der einen Seite, die romantisch verklärte, bisweilen vor Kitsch triefende Szenerie auf der anderen Seite: Dieser Gegensatz der Land-Zuschreibungen ist selbst ein Topos, der den Blick auf „das Dorf“, auf „das Land“ seit langem prägt. (Wunder 1982; Nell/Weiland 2017) Beide Positionen finden sich in den Print- und TV-Medien unserer Tage und haben – bei aller Unterschiedlichkeit – auch einige Gemeinsamkeiten. Zwei seien hier genannt:
- Die zeitliche Komponente, also das „Noch“ in der Hochglanz-Idylle, das „Nicht mehr“ in der Sozialreportage: Diese Verzeitlichung, der Blick in ein wie auch immer geartetes „Gestern“, rückt das Dorf, das Landleben in eine Art Krisenmodus. Aus der einen Sicht wird „Ländlichkeit“ resp. „Dörflichkeit“ als ein bedrohter Zustand interpretiert, als eine Art Residuum, das gepflegt und konserviert, vor äußeren Bedrohungen bewahrt werden muss. Aus der anderen Sicht wird Dörflichkeit als fast verloren oder bereits untergegangen gedeutet: durch die Zersiedlung der Großstadt, durch die Randlage, durch wirtschaftlichen Niedergang, durch das Desinteresse seiner Bewohner oder ähnliches. Dörflichkeit ist aus dieser Perspektive verschwunden, wirkt aber nach und löst gewissermaßen Phantomschmerzen aus – auch das ist letztlich Teil der Verzeitlichung und trägt zum Krisenmodus bei.
- Der Grundton der Nostalgie: Er ist seit je her in Betrachtungen von außen auf das Dorf zu finden (vgl. Wunder 1982: 8-9). Nostalgie sei hier nicht nur verstanden als romantische Verklärung, als Idealisierung einer Vergangenheit, die es nie gegeben hat, sondern auch als eine Art Krisensymptom. Auf diese beiden Seiten der Nostalgie hat der Soziologe Zygmunt Bauman in seiner kurz vor seinem Tod fertiggestellten Gegenwartsanalyse hingewiesen. Bauman spricht von einem globalen Trend, den er mit dem Kunstwort „Retrotopia“ bezeichnet. Darunter versteht er „Visionen, die sich anders als ihre Vorläufer nicht mehr aus einer noch ausstehenden und deshalb inexistenten Zukunft speisen, sondern aus der verlorenen/geraubten/verwaisten, jedenfalls untoten Vergangenheit“ (Bauman 2017: 13). Und an anderer Stelle: „Heute ist es die Zukunft, auf die man nicht vertrauen kann, da sie vollkommen unbeherrschbar erscheint. Sie wird auf der Sollseite gebucht. Dafür erscheint jetzt die Vergangenheit auf der Habenseite – dank ihres Rufs, ein Hort der Freiheit gewesen zu sein, auf den sich noch nicht diskreditierte Hoffnungen setzen lassen.“ (ebd: 10.)
Bauman zitiert die Literaturwissenschaftlerin Svetlana Boym. Ihr zufolge ist Nostalgie „ein Gefühl des Verlusts und der Entwurzelung, zugleich aber auch eine Romanze mit der eigenen Fantasie“ (Boym, zit. n. Bauman 2017:10). Nostalgie ist aus dieser Sicht eine Art Imagination und auch ein „Abwehrmechanismus in Zeiten beschleunigter Lebensrhythmen und historischer Umwälzungen“. Im Kern dieses Mechanismus stecke das Versprechen, „jene ideale Heimat wiederzuerrichten, die im Zentrum vieler heute einflussreicher Ideologien steht und uns dazu verleiten soll, das kritische Denken zugunsten emotionaler Bindungen aufzugeben“. Das Gefährliche daran sei laut Boym die „Neigung, unsere tatsächliche mit einer idealen Heimat zu verwechseln“ (Boym, zit. n. Bauman 2017:11).
Dieser wirklichkeitsnahe Blick auf die „tatsächliche Heimat“, auf die realen Strukturprobleme der ländlichen Räume bzw. der Dörfer spielte in überregionalen Printmedien lange Zeit eher die Rolle eines Nebenschauplatzes. Die Problemlagen, Strukturdefizite und Konflikte im ländlichen Raum kamen in überregionalen Tageszeitungen wie Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung oder Die Zeit in den 1990er und in den 2000er Jahren eher am Rande vor – als Kuriosum bisweilen, aber auch als Beleg dafür, dass man es auf dem Land mit einer rückständigen Zone zu tun habe. Journalistische Beispiele des Lächerlich-Machens, der negativen Berichte und der salopp-überheblichen „Fernsicht auf das Dorf“ (so treffend Henkel 2016 : 248, dort mit Beispielen aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und des WDR-Fernsehens aus dem Jahr 2014) von sicherem Beobachter-Standort einer Großstadtredaktion aus lassen sich mit wenig Mühe finden. Als eine der wenigen positiven Ausnahmen darf eine mehrteilige Reportagereihe gelten, die im Jahr 2006 im Spiegel erschienen ist und sich sehr detailreich mit dem Alltag in den Dörfern befasst hat. (Bölsche 2006a, 2006 b, 2006c)

Die realen Strukturprobleme der ländlichen Räume wie das Hofsterben spielte in den überregionalen Medien eher eine untergeordnete Rolle. / Foto: Aktion Agrar (CC BY 2.0)
Zwar mangelte es zu keinem Zeitpunkt an Dorfstudien, an wissenschaftlich soliden Analysen über den ländlichen Raum und seine Strukturprobleme, vorgelegt etwa vom staatlichen Thünen-Institut – Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei in Braunschweig oder vom privaten Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung (vgl. als Beispiele Thünen-Institut 2015, Kröhnert u. a. 2011). In den Medien allerdings wurden sie lange Zeit eher am Rande wahrgenommen.
Das änderte sich 2016 grundlegend. Als zunächst das Brexit-Referendum in Großbritannien und dann die US-Präsidentschaftswahlen anders ausgingen als von den meisten Beobachtern erwartet, zeigten sich viele Journalisten überrascht. Nur wenige räumten selbstkritisch ein, ihren Blick zu sehr auf die Metropolen gerichtet und die Konfliktlagen in der Provinz dabei aus dem Blick verloren zu haben. Von Großbritannien und den USA wurde dann im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 rasch auf deutsche Problemlagen geschlossen:
„Mehr als die Hälfte der Deutschen lebt fernab der großen Städte. Es sind Millionen Menschen, die Journalisten und Hauptstadtpolitiker zu oft aus den Augen verlieren“– so bekannte durchaus selbstkritisch die Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ im Sommer 2017 (Schumacher 2017). Das Blatt lieferte damit die Begründung für ein Großprojekt: Die Hamburger Wochenzeitung hatte 16 junge Reporter für einen längeren Zeitraum in ein Dorf in Niedersachsen entsandt, um im August 2017 in einer Schwerpunktausgabe von den Menschen und ihren Problemen „in einem gewöhnlichen deutschen Dorf“ zu berichten.
Viele weitere überregionale Medien und Publizisten entdeckten in den Monaten vor der Bundestagswahl „das Dorf“ oder „das Land“. Mehrere Journalisten wanderten in den Jahren 2016/17 durch Deutschland, um mit „normalen Leuten“ zu sprechen und deren Lebenswelten, die Sicht abseits der Metropolen, zu erkunden und zu beschreiben. Im Wahljahr 2017 erschienen Bücher mit Titeln wie
- „Heimaterde – eine Weltreise durch Deutschland“ von Lucas Vogelsang (Vogelsang 2017);
- „Deutschland ab vom Wege. Eine Reise durch das Hinterland“ vom Henning Sußebach, Redakteur bei der „Zeit“ in Hamburg (Sußebach 2017) oder auch
- „Zu Fuß durch ein nervöses Land“ von Jürgen Wiebicke, Redakteur beim WDR Köln (Wiebicke 2016).
Neben der „Zeit“ starteten etliche Redaktionen überregionaler Medien groß angelegte Dorf-Beobachtungsprojekte:
- Die Berliner „Tageszeitung“ unternahm 2016/17 eine ganzjährige Entdeckungstour durch „Mein Land“ und schrieb im Resümee: „Wir wollten fernab der ,Großstadtblase‘ Menschen und ihre Lebensrealitäten zu Wort kommen lassen und Antworten finden.“ (Tageszeitung 2017)
- Der Privatsender RTL quartierte im Sommer 2017 ein Reporterteam für Wochen in eine Land-WG in Rinteln in Niedersachsen ein. Rinteln wurde vom Privatsender zur „Wahlstadt“ erklärt, denn: „Vieles hier entspricht dem statistischen deutschen Mittel.“
- Der Deutschlandfunk startete eine Reportagereihe „Abgehängte Regionen“ und besuchte Landstriche in sieben Bundesländern, denen die Bundesregierung zuvor „sehr stark unterdurchschnittliche Lebensverhältnisse“ bescheinigt hatte. Das Reportageprojekt begründet die DLF-Redaktion – ähnlich wie zuvor „Die Zeit“ – mit dieser These: „Wahlen werden auf dem Land entschieden: Eine Erkenntnis, die nicht nur der Front National und Donald Trump für sich zu nutzen wussten. Auch hierzulande könnte die Alternative für Deutschland zum ersten Mal in den Bundestag einziehen.“ (Deutschlandfunk 2017)
Stellvertretend für die zahlreichen Land-, Dorf- und Provinz-Reportagen sei aus der Süddeutschen Zeitung vom 10. September 2017 zitiert. Kurz vor der Bundestagswahl widmete sie ihren prominenten Platz des Leitkommentars der Lage auf dem Land: „Vielerorts in Deutschland verludern die Ortskerne, sie müssen wiederbelebt werden“, befand der Leiter der Innenpolitik-Redaktion, Heribert Prantl, unter dem bezeichnenden Titel: „Warum die Heimat wichtig für den Wahlkampf ist“ (vgl. Prantl 2017). Den diskutablen Begriff „Heimat“ beschrieb Prantl als „überschaubaren Nahraum“, der Autor befasste sich dann aber weniger mit Stadtquartieren und Vororten, sondern vor allem mit der Wirklichkeit des ländlichen Raums und seinen vielschichtigen Problemen:
„In Österreich und Deutschland leben zwei Drittel der Menschen in Dörfern, in Klein- und in Mittelstädten – also in der Provinz. Österreich und Deutschland sind zu zwei Dritteln Provinz. Provinz ist der Raum der übersichtlichen Lebenseinheiten, der Raum, in dem die Menschen sich kennen. Provinz ist die Verkörperung des Prinzips Heimat. Diejenigen, die sich für das Wort Provinz schämen, sagen lieber Region; meinetwegen. Provinz ist ein gutes Wort und ein guter Platz, um sich heimisch zu fühlen. Er muss es bleiben oder wieder werden.“ (ebd.)

Viele überregionale Medien entdeckten vor der Bundestagswahl 2017 das Thema „Dorf“ und berichteten über die vielschichtigen Probleme wie fehlende öffentliche Verkehrsmittel. / Foto: Soenke Rahn CC BY-SA 4.0
Als Probleme benannte der Süddeutsche Zeitung-Leitartikler unter anderem: „Die Menschen brauchen eine wohnungsnahe Rundumversorgung. Jeder zehnte Einwohner Deutschlands kann Brot und Milch nicht mehr zu Fuß einkaufen, weil der nächste Laden zu weit entfernt ist.“ Prantl fordert: „Öffentliche Verkehrsanbindungen müssen funktionieren, Schulen müssen zu neuen Mittelpunkten des Miteinander- und Voneinander-Lernens umgestaltet werden. Medizinische Betreuung und Pflege müssen neu konzipiert und ausgebaut werden. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist auch ein Kampf gegen die provinzielle Depression.“ Im Kern müsse die Frage stehen, „wie man junge Menschen zum Bleiben oder, noch besser, zur Rückkehr bewegt“. Die Entvölkerung ländlicher Räume sei „kein Naturgesetz, sondern eine Folge dessen, dass Arbeit und Leben auf dem Land nicht oder zu wenig vereinbart werden können“ (ebd.).
Die Sicht dieser und der vielen anderen realitätsnahen Dorf-Beiträge, so weit überschaubar, referierten im Wesentlichen die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien, wie sie etwa das Thünen-Institut oder auch das private Berlin-Institut in der „Vorwahl-Zeit“ zur Problemlage in den ländlichen Räumen Deutschlands aufgelegt haben (Thünen-Institut 2015, Kröhnert u. a. 2011). Die medialen Berichte erweisen sich damit als eine Art Gelenkstelle nicht nur zwischen dörflichem oder „semi-urbanem“ Alltag und einer eher urbanen Leserschaft, sondern auch als Vermittlungsinstanz zwischen universitärer bzw. wissenschaftlicher Forschung zum ländlichen Raum und der sozialen Realität auf dem Land auf der einen Seite, den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft auf der anderen Seite. Das mentale Stadt-Land-Gefälle jedenfalls, die oben benannte mediale „Fernsicht auf das Dorf“ wich einem problemorientierten Blick auf Krisen, Konflikte und mögliche Lösungsansätze.
Was bedeutet das für die Leitfrage nach „Dörflichkeit“? Der Begriff wird aus dieser Sicht vor allem als eine Frage der Infrastruktur gedeutet, die zu sichern, zu bewahren und auszubauen sei. Dieses Ziel wird nicht als Selbstzweck betrachtet, sondern als stabilisierender Faktor gegen populistische Bewegungen, deren Heimstatt vornehmlich „auf dem Land“ gesehen wird (Neu 2016) – diese Vermutung schwingt in vielen Dorf- und Landreportagen der Jahre 2016/2017 mit. Ob diese These zutrifft, wäre eine eigene Untersuchung wert. Für die hiesige Fragestellung bleibt festzuhalten: Das Dorf wird aus dieser medialen Perspektive vor allem als krisenbedrohter Ort für „Kümmerer“ und „Anpacker“, für Ideen und Initiativen gesehen. Dörflichkeit wäre aus dieser Sicht nicht das Abziehbild oberflächlicher Idyllen und romantischer Visionen, sondern „tatsächliche Heimat“ im oben zitierten Sinne (Boym, zit. n. Bauman 2017:10-11) – sprich: ein Ort der Gegenwart, den es zu gestalten gilt.
Das Dorf taucht in aktuellen überregionalen Printmedien aber nicht nur als Ort des romantischen Gestern und des realitätsnahen Heute, sondern auch als Chiffre für Zukunft auf: als Gestaltungs- und Projektionsfläche für Utopieentwürfe und visionäre Planungen. Der Architekturkritiker und Redakteur Gerhard Matzig etwa hat im Dezember 2017 im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung ausdrücklich „Das Dorf von morgen“ beschrieben – so die Überschrift seines Beitrages (Matzig 2017). Der Text präsentiert einige Ergebnisse eines universitären Ideenwettbewerbs zu neuen Wohnraumangeboten, den die NRW-Bank ausgeschrieben hatte (vgl. NRW-Bank 2017). Den Studierenden war demnach die Aufgabe gestellt worden, „über urbane Lebensräume abseits der eigentlichen Urbanitätsmaschinen, also jenseits der Großstädte in der nordrhein-westfälischen Region nachzudenken“, wie Matzig schreibt. Sie hätten „das Land nicht als abgehängten, nur zum Idyll taugenden Gammelraum der Gestrigkeiten, sondern als neues urban-vitales Lebensgefühl“ präsentiert. Man sei abgewichen von der „üblichen Idee vom Landleben“, das laut Matzig definiert sei als „Typologie des Einfamilienhauses, der Automobilität und der Gewerbehöllen“. Davon hätten sich die Beiträge der Studierenden abgesetzt und eine internet-gestützte Lebensform entworfen, „in der Mobilität beispielsweise keine Frage mehr des Privatauto ist, in der Sharing wesentlich für Nachbarschaften ist – und in der ein heterogenes Wohnen, zugleich Arbeiten, in ganz unterschiedlichen, zeitlich und wohnraumtechnisch flexiblen Lebensentwürfen unter einem Dach möglich wird“ (Matzig 2017).
Vom Dorfleben war allerdings in den studentischen Wettbewerbsbeiträgen nur am Rand die Rede (vgl. NRW-Bank 2017). Das einzige Projekt, dem eine gewisse Dörflichkeit bescheinigt werden könnte, bezog sich auf Altenberge, eine immerhin 10 000 Einwohner zählende Gemeinde im Speckgürtel Münsters. Alle anderen Siedlungs- und Bauprojekte bezogen sich auf veritable Kreisstädte wie Herford, Gütersloh oder Bielefeld.
Anders gesagt: Der SZ-Redakteur Matzig verwendet den Begriff „Dorf“ als Chiffre für eine Zukunftsutopie, weitgehend abgelöst von den tatsächlichen Befunden der studentischen Entwürfen. Und mehr noch: Entgegen dem allgemeinen Sprachgebrauch, der „Dorf“ mit „ländlich“ konnotiert, wird der Begriff hier mit den Adjektiven „urban-vital“ charakterisiert und letztlich umgedeutet.
Diese Sicht trieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf die Spitze, als sie im Herbst 2017 ein Magazin-Sonderheft „FAZ Quarterly“ (FAZQ) mit dem Themenschwerpunkt „Raus aufs Land“ vorlegte. Schon auf dem Titelumschlag findet sich die wagemutige These: „Die Städte werden immer öder. Freiheit, Fortschritt und Lebenslust finden wir nur noch auf den Dörfern. Wo die Zukunft ist!“ Das Kernstück dieses Schwerpunktes, ein Feature mit dem Titel „Raus aufs Land“, spitzt diese Leitthese weiter zu: „Die Städte werden immer öder – Reservate für reiche Rentner und Touristen. Während die Zukunft vor die Stadt gezogen ist, wo mehr Platz ist für Experimente, die Suche nach neuen Formen des Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens“ (Maak/Seidl/Wiedemann 2017: 80).
Vorgestellt werden unter anderem High-Tech-Zentren und industrielle Cloud-Speicher der Deutschen Telekom in Biere (Sachsen-Anhalt), ein Flüchtlingsprojekt mit syrischen Flüchtlingen in Gundelsheim (Franken), eine Kommune in Tarnac (Frankreich) sowie das im Jahr 2010 gegründete Öko-Siedlungsprojekt „Gut Tempelhof“ (Baden-Württemberg), das von den FAZQ-Autoren als besonders gelungener Zukunftsentwurf präsentiert wird. Diese Siedlung sei auf einem aufgelassenen Gut als „Mischung aus einer gemeinnützigen Stiftung und einer Genossenschaft“ (ebenda: 93) angelegt worden. Die inzwischen „105 Erwachsenen und 50 Kinder“ betreiben laut FAZQ extensive Landwirtschaft, haben eine Montessori-Schule eine Dorfkantine und ein Café eröffnet, und sie verwenden modernste Technik wie etwa ein Glasfasernetz oder ein Wissenschaftslabor, um ökologische Bauprojekte oder auch neue Möglichkeiten der Energiegewinnung zu entwickeln.
Über das Miteinander, die Kommunikation innerhalb der Tempelhof-Gemeinschaft teilt das FAZQ-Feature wenig mit. Von regelmäßigen Plenumssitzungen ist immerhin die Rede, von einer Satzung, die man sich bei der Gründung gegeben hat, von einem Ideen- und Geldgeber und von einer solidarischen Gemeinschaft, die mittlerweile auch Leute aufnehme, „die es sich nicht leisten können“. Auch das überlappende Nebeneinander von Privatem und Öffentlichem wird angedeutet: „In der Mitte gibt es Gemeinschaftsräume, außen herum Privatbereich. 25 Menschen wohnen im Haus und um das Gebäude herum. Singles, Paare und Alleinerziehende“ (ebd.: 94)
Dieses und die anderen angeführten Projekte feiern die FAZQ-Autoren als „futuristisches Gegenmodell zur Nostalgisierung des Lebens“. Damit sei „das Land“ ein Raum der Freiheit und der Zukunft geworden – sie werde „weniger in den totregulierten, überkontrollierten Städten, sondern im offenen Raum des Landes zu finden sein“ (ebd.). Dieses Urteil überrascht insofern, als die Autoren nur wenige Absätze zuvor dargelegt haben, dass das Siedlungsprojekt Tempelhof sehr wohl seine Regeln und Kontrollen kennt. Doch am Ende landet auch das utopisch ausgemalte Feature wieder bei den Begriffen, die gewissermaßen „alte Bekannte“ aus der Wissenschaftstradition der Dorf-Forschung sind: Gemeinschaft, Zusammenhalt und die Überlappung des privaten und des öffentlichen Bereichs.
Nicht allen, aber den meisten der hier genannten Medienbeiträge und Themenschwerpunkte ist eines gemein: Sie vermessen auf je unterschiedliche Weise und in durchaus unterschiedlicher Intensität das Land, tun dies aber fast immer in Bezug zur Stadt. Der urbane Raum und seine kommunikativen Regeln bilden einen trigonometrischen Punkt, von dem aus das Land und die Dörfer vermessen werden. Dieser Vermessungspunkt wird in den einzelnen Texten mal mehr, mal weniger deutlich sichtbar. Gelegentlich grenzen sich die Autoren klar von der Stadt und ihren Regeln ab, so etwa in den zitierten Beiträgen der FAZQ-Sonderheftes – aber selbst dann noch bildet der urbane Raum den Bezugspunkt. Anders gesagt: Das Landleben und die Dörfer werden überwiegend nach den Regeln der Metropolen verstanden, dargestellt und gedeutet.
Zum einen ist das mit den Bedingungen medialer Produktion zu erklären: Die meisten Journalisten, die für überregionale Tages- und Wochenzeitungen oder Rundfunksender tätig sind, arbeiten nun einmal in den Metropolen. Dort lebt auch die Mehrheit ihre Publikums, und, nicht zu vergessen, dort haben auch die meisten Anzeigenkunden ihren Firmensitz.
Zum anderen spielt die Prägung der agierenden Journalistinnen und Journalisten eine – letztlich schwer zu gewichtende – Rolle, also Herkunft und Habitus, Bildung und Besitz, sozialer und politischer Standort. Immerhin ist gut belegt (Steindl et. al. 2017), dass die Mehrheit der derzeit rund 45.000 hauptberuflich tätigen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland aus der akademischen Mittelschicht, also aus einem meist urban geprägten Umfeld stammt, dass die meisten von ihnen eine universitäre Laufbahn und damit eine entsprechende Sozialisation absolviert haben und auch, dass sie selbst sich politisch im Gesamtdurchschnitt als „eher links von der Mitte“ (ebenda : 414) einordnen.
Diese – hier stark generalisierte – Einstellung der Journalisten unterscheidet sich mehr oder weniger deutlich von den Mentalitäten der ländlich-dörflichen Bevölkerung.Die Differenzen dürften einer „romantischen“ oder „utopischen“ Medien-Sicht auf Dorf und Land nicht im Weg stehen – umso mehr indes, wenn es gilt, den „tatsächlichen“ dörflichen bzw. ländlichen Kosmos aus seinen jeweils eigenen Regeln heraus zu erkunden und medial zu beschreiben. Ob eine solche journalistische Beschreibung der „tatsächlichen Heimat“ und seiner sozialen und wirtschaftlichen Problemlagen von den Medienkonsumenten stets erwünscht wird, erscheint allerdings fraglich. Auch das belegt die nach wie vor hohe Nachfrage und der Erfolg der Hochglanz-Landmagazine und -sendungen.
Literatur:
- Baumann, Christoph: Idyllische Ländlichkeit. Eine Kulturgeographie der Landlust, Bielefeld 2018.
- Bauman, Zygmunt (2017): Retrotopia. Berlin.
- Biermann, Kai (2017): Hinter Berliner Zäunen, in: Die Zeit, 6. Juni 2017, www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-05/altglienicke-ost-berlin-mauer-cdu-heimatreporter-d17.
- Bölsche, Jochen (2006a): Deutsche Provinz – Verlassenes Land, verlorenes Land. Spiegel online, 14. März 2006: www.spiegel.de/politik/deutschland/deutsche-provinz-verlassenes-land-verlorenes-land-a-404888.html.
- Bölsche, Jochen (2006b): Sterbendes Land: Keine Zukunft für die Kuhzunft – Spiegel online, 15. März 2006: www.spiegel.de/politik/deutschland/sterbendes-land-keine-zukunft-fuer-die-kuhzunft-a-404891.html.
- Bölsche, Jochen (2006c): Verlassenes Land – Lockruf der Leere“ – Spiegel online, 20. März 2006: www.spiegel.de/politik/deutschland/verlassenes-land-lockruf-der-leere-a-406499.html.
- Deutschlandfunk (2017): Abgehängte Regionen. www.deutschlandfunk.de/abgehaengte-regionen.3378.de.html.
- Frieling-Huchzermeyer, Ute (2005): Editorial. In: Landlust. Heft 1 / November/Dezember 2005. Landwirtschaftsverlag Münster S. 3.
- Henkel, Gerhard (2016): Rettet das Dorf! Was jetzt zu tun ist, München.
- Herrmann, Carolin (1993): Im Dienste der örtlichen Lebenswelt. Lokale Presse im ländlichen Raum, Opladen
- Hoolt, Anne-Marlen (2017): Erholung, Harmonie und Heimat. Deutschlandfunk, 5. Oktober 2017. – www.deutschlandfunk.de/erfolgszeitschrift-landlust-erholung-harmonie-und-heimat.2907.de.html?dram:article_id=397464.
- Ilien, Albert /Jeggle, Utz (1978): Leben auf dem Dorf. Zur Sozialgeschichte des Dorfes und zur Sozialpsychologie seiner Einwohner, Opladen.
- Kröhnert, Steffen / Kuhn, Eva / Karsch, Margret / Klingholz, Reiner / Bennert , Wulf – Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung (2011): Die Zukunft der Dörfer. Zwischen Stabilität und demografischem Niedergang.
- Maak, Niklas / Seidl, Claudia / Wiedemann, Carolin: Raus aufs Land. In: FAZ Quarterly, Heft 4 , Herbst 2017, S. 78-94.
- Matzig, Gerhard (2017): Das Dorf der Zukunft. In: Süddeutsche Zeitung, 14. Dezember 2017, S. 9.
- NDR (2011): Schönes Landleben XXL. – http://www.dmfilm.de/schones-landleben.
- NDR (2013): Schönes Landleben auf dem Hof Wörme. Erstausstrahlung am 2. 10. 2013. Presseankündigung: programm.ard.de/TV/Programm/Sender/?sendung=2822611416912396. (08.07.2018).
- Nell, Werner /Weiland, Marc (2015): Imaginationsraum Dorf, in: Dies.(Hg.), Imaginäre Dörfer. Zur Wiederkehr des Dörflichen in Literatur, Film und Lebenswelt. Bielefeld 2014), S. 13-50.
- Neu, Claudia (2016): Neue Ländlichkeit. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 46-47, 11. November 2016, S. 4-9.
- NRW Bank (2017): Wachstum in Kooperation: Neue Wohnraumangebote in der Region. Studentischer Ideenwettbewerb. Düsseldorf. – Onlineversion: www.nrwbank.de/de/themen/wohnen/NRW.BANK.Studierendenwettbewerb.html
- Prantl, Heribert (2017): Warum die Heimat wichtig für den Wahlkampf ist. In: Süddeutsche Zeitung, 10. September 2017, S. 4. – online: http://www.sueddeutsche.de/politik/prantls-blick-warum-die-heimat-wichtig-fuer-den-wahlkampf-ist-1.3660928. (08.07.2018).
- Schumacher, Florentine (2017): Emsland. Morgens halb acht in Werpeloh. In: Zeit Online, 30. August 2017. https://www.zeit.de/2017/36/werpeloh-baecker-morgens. (08.07.2018).
- Steindl, Nina/Lauerer, Corinna/Hanitzsch, Thomas (2017): Journalismus in Deutschland. Aktuelle Befunde zu Kontinuität und Wandel im Deutschen Journalismus, in Publizistik Bd. 62, S. 401-423.
- Sußebach, Henning (2017): Deutschland ab vom Wege. Eine Reise durch das Hinterland, Hamburg.
- Tageszeitung (2017): Über Taz.meinland. Unser Projekt im Überblick. In: http://www.taz.de/Ueber-tazmeinland/!1163412/. (08.07.2018).
- Tönnies, Ferdinand (1887): Gemeinschaft und Gesellschaft. Leipzig
- Thünen-Institut für Ländliche Räume (Red.) (2015): Ländliche Lebensverhältnisse im Wandel 1952. 1972, 1993, 2012, Bd. 1 bis 6, Braunschweig.
- Vogelsang, Lucas (2017): Heimaterde. Eine Weltreise durch Deutschland, Berlin.
- Wiebicke, Jürgen (2016): Zu Fuß durch ein nervöses Land. Auf der Suche nach dem, was uns zusammenhält, Köln.
- Winterbauer, Stefan (2011): Welches Land-Heft macht die meiste Lust? In: Meedia, 14. März 2011. –www.meedia.de/2011/03/14/welches-land-heft-macht-die-meiste-lust.
- Wunder, Heide (1986):; Die bäuerliche Gemeinde in Deutschland, Göttingen.