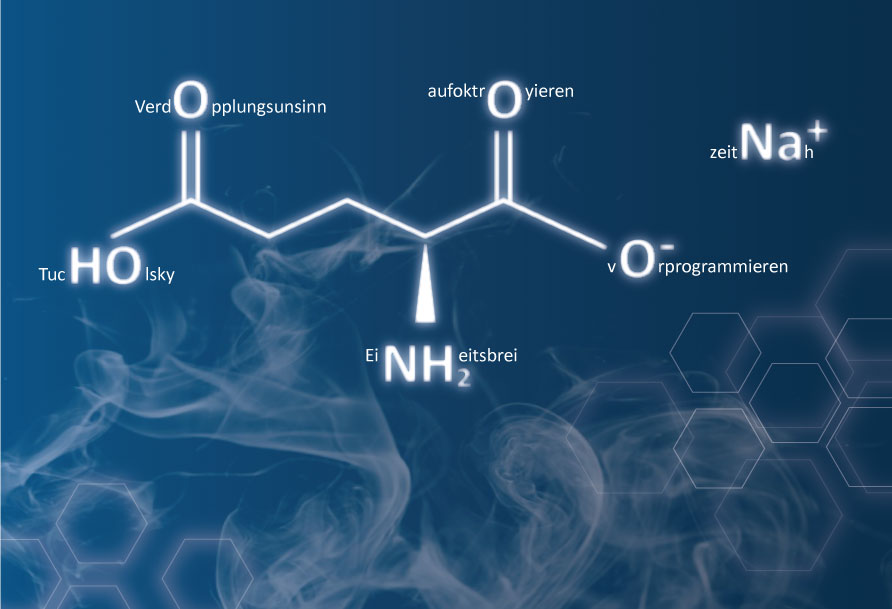#NR24 | Sprache
“Eine Sprache der Zuspitzung” (3. September 2024)

Als Nachrichtenchef der dpa weiß Froben Homburger um die Relevanz präziser Sprache und die Folgen einer unüberlegten Wortwahl. Ein Gespräch über Zeitdruck, Gendern und angebliche Zensur.
Herr Homburger, Sie gelten als Mann der ganz genauen Sprache. Aber wir alle machen Fehler. Was ist der größte sprachliche Fehler, der Ihnen unterlaufen ist?
Ach, ich habe da kein Ranking, bin aber alles andere als fehlerfrei, gerade in der gesprochenen Sprache. Beim Reden rutschen mir immer wieder Formulierungen raus, die mich im Nachhinein ärgern oder die ich sogar bedauere – weil sie missverständlich sind, weil sie unpassend sind, weil sie im schlimmsten Fall sogar Menschen verunsichern oder kränken. Sprache ist komplex, Sprache ist mächtig, und angesichts dieser Komplexität und Macht ist gedankenlose Dampfplauderei verführerisch einfach. Anders ist es beim Schreiben: Selbst bei privaten Mails wäge ich Satz für Satz oft sehr genau ab. In mehr als 30 Jahren Agenturjournalismus habe ich viel zu häufig erlebt, wie weitreichend die Folgen unpräziser Schriftsprache sein können.
Ist die Wortwahl im Journalismus eine Frage der Sorgfaltspflicht oder nicht doch einfach eine des Stils?
Eine Sprache, die zwar schön zu lesen, aber nicht präzise ist, ist in der Belletristik besser aufgehoben als im Journalismus. Eine Sprache, die zwar präzise, aber nicht schön zu lesen ist, ist in der Wissenschaft besser aufgehoben als im Journalismus. Daher: Sorgfalt und Stil sind beides wichtige Faktoren für guten Journalismus.

„Zensur wird gerne als politischer Kampfbegriff bemüht, um sich mit dem Thema Sprachsensibilität gar nicht erst befassen zu müssen“, sagt dpa-Nachrichtenchef Froben Homburger. (Foto: Michael Kappeler)
Ihr Eindruck als professioneller Leser: Hat die sprachliche Sorgfalt im deutschen Journalismus abgenommen?
Auch die Mediensprache verändert sich, aber nach meinem Empfinden in der Summe nicht zum Schlechteren. Ich glaube, dass die meisten Redaktionen heute sprachsensibler sind als früher. Das hat viel auch mit Impulsen und Interventionen jüngerer Kolleginnen und Kollegen zu tun. Sprachdebatten in den Newsrooms der 90er Jahre drehten sich eher um die Frage, ob „durch“ nur räumlich („durch den Tunnel“) oder auch kausal („starb durch eine Polizeikugel“) verwendet werden darf. Heute hinterfragen wir viel stärker etwa Ausrichtung und Macht der Bilder, die bestimmte Begriffe im Kopf erzeugen – und entscheiden auf dieser Grundlage, ob und in welchem Kontext wir sie benutzen.
Warum sind Sprachsensibilität und präzise Formulierungen generell wichtig in der journalistischen Berichterstattung? Warum macht es zum Beispiel einen Unterschied, ob man Verschwörungstheorie oder –ideologie sagt?
Journalistische Sorgfalt bedeutet immer auch das Ringen um die richtigen Worte. Unpassende Begriffe können in die Irre führen, Dinge verschleiern und verharmlosen, aber umgekehrt auch unnötig dramatisieren. Allerdings sehe ich da schon auch einen Spielraum, gerade wenn es um Fachtermini geht. Der Pressekodex formuliert das für Rechtsthemen sehr hübsch so: „In der Sprache der Berichterstattung ist die Presse nicht an juristische Begrifflichkeiten gebunden, die für den Leser unerheblich sind.“ Und auch die Unterscheidung zwischen Verschwörungstheorie und Verschwörungsideologie ist aus meiner Sicht eher etwas für Feinschmecker. „Theorie“ legt zwar eine gewisse Wissenschaftlichkeit nahe, und „Ideologie“ trifft es daher sicher besser. Aber ich glaube nicht, dass „Verschwörungstheorie“ sträflich stark vernebelt, um was es tatsächlich geht.
Schnelligkeit ist ein entscheidender, aber auch riskanter Faktor in der Berichterstattung. Wie beeinflusst Zeitdruck ein präzises Wording?
Zeitdruck erhöht die Fehleranfälligkeit jeder Tätigkeit. Bei Eilmeldungen besteht die größte Gefahr darin, ein noch unklares Geschehen voreilig zu labeln. Wenn erst einmal der „Amoklauf“ gepusht wurde, obwohl zunächst nur von „Schussgeräuschen“ an einer Schule die Rede ist, oder der „mutmaßliche Terroranschlag“ am Ende doch auf das Konto einer kriminellen Bande geht, können auf die Schnelle fahrlässig und fatal falsche Zeichen gesetzt werden. Das beste Mittel dagegen: Gerade unter Zeitdruck mit möglichst einfachen Worten nüchtern nur das beschreiben, was absolut unzweifelhaft ist. Für einordnende Labels ist später immer noch Zeit.
Überspitzte Formulierungen tauchen vermehrt auch bei Qualitätsmedien auf. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Natürlich bildet auch der professionelle Journalismus teils die sprachliche Polarisierung ab, die die Debattenkultur vor allem in den sozialen Medien prägt. Dort ist eine Art Bekenntnisdrang zu beobachten: Erfolgreich sind pointierte Stellungnahmen, egal zu was. Das fördert eine Sprache der Zuspitzung, weil sachliches Beschreiben nicht so viel Aufmerksamkeit generiert wie scharfes Urteilen. Im professionellen Journalismus kann Zuspitzung aber durchaus ein legitimes Stilmittel sein, etwa um den zentralen Aspekt eines komplexen Sachverhalts hervorzuheben. Aber klar: Zuspitzung hat immer das Potenzial, ein Geschehen zu überzeichnen und damit zu verzerren. Daher: Jede Zuspitzung in der Berichterstattung erfordert besonders viel journalistische Sorgfalt.
Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel: Das Wort „Beziehungstat“ taucht immer wieder in der Berichterstattung auf, obwohl seit langem beklagt wird, dass damit strukturelle Gewalt gegen Frauen verharmlost wird. Wie kommt das?
Bei dpa stehen Begriffe wie „Beziehungsdrama“ und „Familientragödie“ seit knapp fünf Jahren auf dem Index – außer in der direkten oder indirekten Wiedergabe von Zitaten. „Drama“ und „Tragödie“ verschleiern die gezielte, tödliche Gewalt, die sich vor allem gegen Frauen richtet. Sie verklären Mord und Totschlag zu einem schicksalhaften Geschehen, in dem Opfer- und Täterrolle zu verschwimmen scheinen. Nicht auf dem Index steht dagegen bei uns die „Beziehungstat“, denn während landläufig darunter ein Verbrechen innerhalb einer partnerschaftlichen Beziehung verstanden wird, meint die Polizei damit oft lediglich, dass sich Oper und Täter irgendwoher kannten, der getötete Mensch also kein Zufallsopfer war.
Diesen Unterschied zwischen polizeilichem und allgemeinem Verständnis müssen wir aber bei Formulierungen wie „Die Polizei sprach von einer Beziehungstat“ zwingend klarstellen, um am Ende nicht doch zur Verharmlosung von Femiziden beizutragen. Der Begriff „Femizid“ selbst wiederum verbreitet sich auch in Deutschland vor allem im politischen Diskurs immer stärker und wird grundsätzlich auch von dpa benutzt. Da er aber für viele Menschen noch immer nicht selbsterklärend ist, verwenden wir ihn inklusive eines kurzen Hintergrunds eher im weiteren Verlauf eines Textes und nur in Ausnahmefällen schon in Titel und Leadsatz.
Im Journalismus werden wiederholt Begriffe aus Firmen-PR genutzt, zum Beispiel der Name „Gigafactory“ für eine Tesla-Fabrik. Inwiefern bedroht das die Glaubwürdigkeit des unabhängigen Journalismus?
Namensgebung ist immer auch PR. Aber deshalb auf die korrekte Namensnennung zu verzichten, kann ja nicht die Lösung sein. Die PR-Gefahr im Journalismus lauert ohnehin sehr viel stärker im Spin einer Mitteilung, in einer selektiven Darstellung – häufig schlicht in dem, was nicht oder zumindest nicht freiwillig gesagt wird. Jeder Mitteilung zu misstrauen, jede Stellungnahme zu hinterfragen, ist das beste Instrument, um am Ende keiner PR-Strategie zu erliegen, um unabhängig und damit glaubwürdig zu bleiben.
Das Neuverhandeln von Begrifflichkeiten gefällt nicht allen. Wenn nun diskutiert wird, Geflüchtete statt Flüchtlinge zu sagen, wittern Kritiker gleich Zensur.
„Zensur“ wird gerne als politischer Kampfbegriff bemüht, um sich mit dem Thema Sprachsensibilität gar nicht erst befassen zu müssen. Der Vorwurf ist aber auch deshalb absurd, weil es ja jedem Menschen und Medium überlassen bleibt, strittige Begriffe weiter zu verwenden, solange sie nicht rechtswidrig sind. Bei dpa darf man im Übrigen weiterhin sowohl Geflüchtete als auch Flüchtlinge schreiben. Anders als oft argumentiert handelt es sich bei „-ling“ nicht um eine durchgängig negativ konnotierte Wortendung.
Die dpa spricht sich für gendersensible Sprache im Journalismus aus. Wie erleben Sie in der Redaktion die Diskussion ums Gendern? Ist sie die ganze Aufregung wert?
Vor drei Jahren hat sich dpa mit den anderen deutschsprachigen Nachrichtenagenturen auf eine gemeinsame Linie verständigt: Wir verzichten bis auf weiteres auf Gendersonderzeichen, nutzen aber stärker jenen gendersensiblen Spielraum, den uns die Sprache jetzt schon lässt. Wir verwenden also häufiger als früher geschlechtsneutrale Begriffe oder Paarformen. Natürlich gab und gibt es in unserer Redaktion dazu viel Diskussionsbedarf, zumal die Rolle der dpa hier eine besondere ist: Auf der einen Seite sind wir dank unserer Verbreitung auch in solchen Fragen ein Taktgeber für die deutsche Medienlandschaft; auf der anderen Seite sind wir ein Dienstleister, der sich auch an den Bedürfnissen und Wünschen seiner Kunden zu orientieren hat. Und ja: Ich persönlich finde, dass jede Diskussion um Sprachsensibilität die Aufregung wert ist.
Ist die Forderung nach einer diskriminierungsarmen Sprache berechtigt oder schlagen deren Verfechter über die Stränge?
Eine gemeinsame Sprache ist immer auch ein Kompromiss. Sie wird niemals alle Individuen und Gruppen dieser Sprachgemeinschaft gleichermaßen sichtbar machen können. Sonst verlöre sie irgendwann ihren Charakter als kommunikativer Kitt einer heterogenen Gesellschaft und würde im wahrsten Sinne des Wortes unverständlich. Das sehen natürlich jene anders, die sich in der gemeinsamen Sprache nicht berücksichtigt fühlen. Die Herausforderung besteht also darin, tatsächliche oder zumindest so empfundene Diskriminierung zu reduzieren, ohne die Sprache für eine große Mehrheit der Gesellschaft unverständlicher zu machen. Ein Beispiel: dpa verzichtet in der Berichterstattung über non-binäre Menschen auf alle sprachlichen Mann-Frau-Zuschreibungen und formuliert also beispielsweise so, dass keine Pronomen benötigt werden. Aber: Auch wenn die non-binäre Person das für sich wünscht, verwenden wir keine englischen Pronomen und auch keine sogenannten Neopronomen wie „xier“ oder „dey“. Sie entsprechen zum einen nicht den Rechtschreibregeln und wären zum anderen für die große Mehrheit der Gesellschaft unverständlich.
Als Nachrichtenagentur hat die dpa großen Einfluss auf die Sprache in deutschen Medien. Wie gewährleisten Sie, dass Sie dieser Verantwortung gerecht werden?
Durch ständiges Hinterfragen und häufigen Austausch – mit unseren Kunden, mit manchen Kritikerinnen und Kritikern und sehr stark auch untereinander in der Redaktion. Wir profitieren sehr von der Schwarmsensibilität unserer Kolleginnen und Kollegen, die in einem eigenen Slack-Channel immer wieder wertvolle Hinweise geben und beherzt über Sprache diskutieren.
Dieser Text stammt aus dem „Nestbeschmutzer„, der Zeitung zur Jahreskonferenz von Netzwerk Recherche. Die Fragen stellte Maira Mellinghausen.