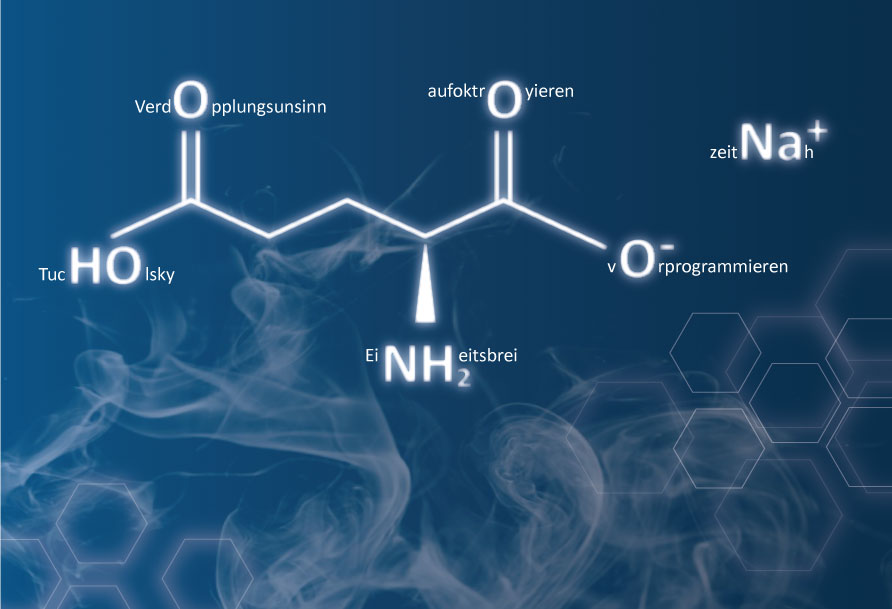Sprache
Über Geschmacksverstärker
Natürlich muss man Texte würzen – nur nicht mit unnützen Vorsilben,
Phrasen und schiefen Metaphern. Eine Polemik über Sprachmarotten
in deutschen Redaktionen.
von Peter Zudeick
Mit Glutamat – dessen Strukturformel wir hier ein wenig umgestaltet haben – wird das Phrasenschwein erst recht ungenießbar. Illustration: Ute Lederer
Wenn Politiker und andere Gestalten des öffentlichen Lebens öffentlich reden, haben Journalisten viel Spaß. Denn wo viel geredet wird, kommt auch ziemlich viel Unsinn heraus. Und es wird viel geredet, vor allem in der Politik. Viel zu viel. Nicht nur im Bundestag, im Bundesrat, auf Parteitagen, Konferenzen, in Interviews, Talkshows und anderen Sabbelrunden. Vor allem Spitzenpolitiker müssen ständig irgendein Zeug reden. Und so hört sich das dann auch an.
Und wir Journalisten? Können es auch ganz gut, das sinnfreie Geplapper. Vor allem diejenigen, die den öffentlichen Akteuren allzu nahe sind. Bei aller behaupteten professionellen Distanz möchten einige von uns – ob sie das nun wissen oder nicht – auch ein bisschen dazugehören. Zur Glanz- und Glamourwelt des Showgeschäfts, zum Jungmillionär-Milieu des Profi-Fußballs, zur politischen Klasse. Und da gibt es ein ganz probates Mittel, diese Wunschnähe zu demonstrieren, ohne sich direkt ranzuschleimen. Man muss nur so sprechen wie sie.
Und das heißt zunächst: Genau die ausgelutschten Bilder und Floskeln benutzen, die im öffentlichen Sprechen so beliebt sind. Die »Spitze des Eisbergs« wird auch von Journalisten immer wieder gerne genommen. »Wir sind gut aufgestellt«, dieser blödsinnige Allerweltsspruch von Politikern, die nun wirklich gar nichts mehr zu sagen haben, ist längst ins Dummdeutsch vieler Medienwerker übergegangen. Auch werden immer wieder »verkrustete Strukturen aufgebrochen«, noch viel lieber wird »zum Denken angeregt« oder gar »aufgerüttelt« – zum Beispiel wenn Journalisten in all ihrer Hilf- und Wortlosigkeit über neue Phänomene wie die Piratenpartei berichten sollen. Selbstredend ist da auch viel von »kapern« und »versenken«, »entern« und »Beute machen« die Rede.
Gruselkabinett des Dummdeutschen
Besonders nah sind sich Journalisten und Politiker im Jargon. Spitzenpolitiker aller Couleur reden mit Vorliebe von den »Märkten« oder den »Finanzmärkten«, als wären das Menschen, Individuen. Journalisten tun es ihnen nur zu gerne nach. Die Märkte sind nervös, sie haben Angst, sie reagieren hektisch. So redet man, um nicht Ross und Reiter nennen zu müssen. Dabei besteht der Markt – wie jeder wissen kann – aus Händlern, die haben einen Namen. Das sind Großbanken, Pensionsfonds, Hedgefonds und dergleichen mehr, die mit mehr oder weniger virtuellen Werten herumjonglieren und mit Wetten auf Plus oder Minus Geld verdienen. Aber Journalisten sagen lieber Sätze wie der ZDF-Börsenexperte: »Der Geduldsfaden der Märkte mit Griechenland ist längst gerissen.« So geht politik-kompatibles Sprechen.
Man hält es ja sowieso kaum für denkbar, was sprachlich alles noch möglich ist. Eigentlich wissen wir doch, dass Preziosen wie »zeitnah« und »zielführend« ins Gruselkabinett des Dummdeutschen gehören. Was aber beträchtliche Teile der deutschsprechenden Gemeinschaft durchaus nicht davon abhält, diese Folterinstrumente munter weiter einzusetzen. Es mag auch sein, dass inzwischen jeder mitbekommen haben kann, ja muss, dass das Wort »vorprogrammiert« schlichter Unsinn ist. »Programmiert« heißt nun mal »vor-schreiben«, vorab festlegen. Das »vor« ist so überflüssig wie ein – hier setzen Sie bitte ein Allerweltswort Ihrer Wahl ein. Nützt nichts: »Vorprogrammiert« hört und liest man allenthalben, sogar in wissenschaftlichen Aufsätzen.
Auch andere Mitglieder des Vereins »Verdopplungsunsinn« treiben im Journalistendeutsch munter ihr Unwesen. Ein ganz alter Bekannter hat sich kürzlich wieder im Radio gemeldet: »Aufoktroyieren«. Also aufaufzwingen. Oder »loslösen« – einer meiner Lieblinge in dieser Kategorie. Wann immer mir dieser Bastard begegnet, versuche ich mir vorzustellen, was wohl »festlösen« bedeuten mag. Denn ohne »fest« kein »los«. Die Vorsilbe dient der näheren Bestimmung des Verbs. Wenn das Verb eindeutig ist, brauche ich keine Vorsilbe. »Lösen« heißt losmachen. Und von »loslosmachen« muss ich nur sprechen, wenn es auch ein »festlosmachen« gibt. Aber was willst du machen? Seit Peter Schilling von der »Neuen Deutschen Welle« ist der Bastard kanonisch: »Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos« – ein deutscher Popstar kann nun mal nicht irren.
Alte Phrasen, neu renoviert
Dabei wollen wir gar nicht von den schwierigen Fällen reden. Zum Beispiel von der Frage, warum es neben dem schönen Wort »steigen« auch noch »aufsteigen« geben muss. Oder gar »emporsteigen«. Steigen heißt »in die Höhe gehen«, »sich nach oben bewegen«. Wozu brauche ich also Wörter wie »ansteigen« oder »aufsteigen«? Ganz einfach: Weil es das Wort »absteigen« gibt. Eigentlich ein rechter Unsinn. Denn das Gegenteil von »steigen« heißt »fallen« oder »sinken«. Und da gibt es kein »auf« oder »ab«. Eigentlich. Denn tatsächlich gibt es »absinken«. Warum? Weil wir der schönen schlichten Bedeutung eines Wortes nicht vertrauen. Oder sie nicht mehr kennen. Dann werden Geschmacksverstärker eingesetzt. Vorsilben haben diese Funktion.
»Stürzen« ist eine besonders intensive Form von fallen. Da geht’s so richtig runter. Rauf ist nicht vorgesehen. Warum redet man trotzdem von »abstürzen«? Weil man dem Wort noch einen kleinen Schubs geben will, damit auch jeder versteht, was gemeint ist. Als wäre das vorsilbenlose Wort nicht stark genug.
Und so reden wir munter von »ausbalancieren« und »durchpassieren«, der Duden kennt sogar das absolute Unsinnswort »zurückerinnern« – wie, zum Teufel, soll ich mich »vorwärtserinnern«? Das geht nicht einmal in der Science-Fiction. Nur: Wenn der Blödsinn schon im Duden steht, wie soll ich Journalistenkolleg(inn)en schelten, wenn sie den Blödsinn nachplappern? Ja, gut, man könnte mal selbst nachdenken. Aber vermutlich ist das zu viel verlangt.
Und überhaupt: Manchmal freut man sich ja auch, alte Bekannte wiederzutreffen. Kürzlich tauchte sogar mein absoluter Liebling wieder auf: »neu renovieren«. Nicht in Immobilienanzeigen. Im Radio. Und wieder wartete ich vergeblich darauf, dass mir mal einer erklärt, wie man »alt renoviert«, also etwas alt erneuert. Das ist doch eine spannende Frage.
»Licht am Ende des Solartunnes«
Ja, ich kenne die Einwände einer bestimmten Richtung der Sprachwissenschaft. Wörter erleben einen Bedeutungswandel, heißt es da. Warum also nicht »neu renovieren«? Vielleicht weil bei allem Wandel »renovieren« immer noch »erneuern« heißt und nichts anderes. Das müssen die Sprecher aber nicht wissen, sagen die Relativisten. Sondern nur das, was für die Kommunikation wichtig ist. Schön. Dann ist aber auch nicht einzusehen, warum ich auf dem Markt sagen soll: »Zwei Pfund Strauchbohnen bitte.« Es genügt doch, auf die Dinger zu zeigen und beim Abwiegen »Aga, aga« zu rufen, wenn zwei Pfund erreicht sind. Mir soll’s recht sein. Nur: Journalisten sollten dann doch ein paar Schrittchen weiter sein als der Neandertaler.
Andererseits weiß man ja auch, dass das Allerweltsdeutsch meist aus Bequemlichkeit, manchmal aus Dummheit, selten aber aus Bosheit verwendet wird. Auch und gerade im öffentlichen Sprachgebrauch. Was machen Nerven? Sie liegen blank, was sollen sie auch sonst tun. Was machen Fragen? Sie brennen. Logisch. Immer wieder auf den Nägeln. Wo sonst. Und Ahnungen sind dunkel, das versteht sich. Und weil die Menschen halt so reden, reden auch Journalisten so. Vielleicht verstehen sie das unter Volksnähe.
Das nähme man gerne in Kauf, wenn dafür der Metaphernkelch an uns vorüberginge. Vor allem Wirtschaftsjournalisten treiben nur allzu gerne ihren Possen mit Sätzen wie »Wachstumsmotor stottert« oder »Neues Schlafmittel weckt Aktionäre auf«. Da kann uns auch die dpa-Überschrift »Deutsche Klavierindustrie ist gut gestimmt« nicht mehr besonders schrecken. Nur, liebe Kollegen: Könnt ihr auch noch was anderes als kalauern? Ich frag‘ ja nur.
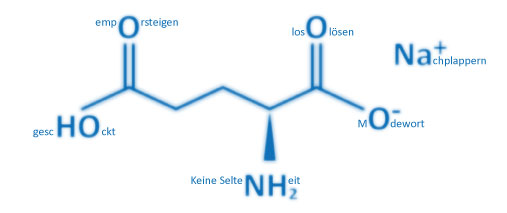 »Wenn der Blödsinn schon im Duden steht, wie soll ich Journalistenkolleg(inn)en schelten, wenn sie den Blödsinn nachplappern?« Illustration: Ute Lederer
»Wenn der Blödsinn schon im Duden steht, wie soll ich Journalistenkolleg(inn)en schelten, wenn sie den Blödsinn nachplappern?« Illustration: Ute Lederer
Wie fasst der Agenturjournalist die Tatsache in Sprache, dass ein Produzent von Solarmodulen nach schweren Zeiten wieder Hoffnung schöpft? Nun ja, er könnte sagen: »Licht am Ende des Solartunnels«. Nur um uns eine Freude zu machen. Aber das war dem Kollegen von Reuters zu billig. »Solon sieht Tal der Tränen fast durchschritten«, dichtet er. Immerhin: nicht durchschwommen. Das hat schon was. Und dann der vornehme Gestus: »Sieht durchschritten«, und zwar nicht gänzlich, sondern »fast«. Das hat Format.
Schon erscheint der alte Solon vor unserem geistigen Auge, der nicht nur athenischer Staatsmann, großer Reformer und einer der sieben Weisen Griechenlands war, sondern auch Lyriker. »Siegle deine Worte mit Schweigen, dein Schweigen mit dem rechten Augenblick« ist einer von Solons berühmten Sprüchen. Kein Spruch für Journalisten, wie wir leicht erkennen können.
Denn würde diesem Ratschlag Folge geleistet, könnten die schönsten Exemplare deutscher Journalistenpoesie nie, na, was jetzt? Jawoll: Das Licht der Welt erblicken. Was sagt man, wenn ein alter Papst abtritt und sich der Trauergemeinde auf dem Petersplatz oder vor dem Castel Gandolfo zuwendet? Oder wenn ein neuer Papst inthronisiert wird und allerlei Worte und Gesten an die Gemeinde richtet? »Der Hirte nahm sich Zeit für seine Herde.« Das sagt man. Ja, sicher, das ist abgedroschen. Aber wer sagt denn, dass Journalistenpoesie eine andere Qualität haben muss als der Kalenderspruch fürs Altenheim?
Nur nicht zu lyrisch werden
Um richtig originell zu sein, muss man schon ordentlich hinlangen wie die Tageszeitung Die Welt. Die Schlagzeile »Die Love-Parade des Tango-Papstes« ist so zupackend und unmittelbar überzeugend, dass keiner auf die Idee kommen wird, ihren Sinn zu hinterfragen. Was sich freilich lohnen könnte. Wir wollen jetzt nicht daran herummäkeln, dass ein Gottesmann »Tango-Papst« genannt wird, nur weil er aus Argentinien kommt. Viel fruchtbringender ist doch die Überlegung, wie eine Love-Parade aussehen müsste, bei der nicht ekstatischer und offen sexueller Rave, sondern artifizieller und krypto-sexueller Tango den Takt angäbe. Großartig, diese Vorstellung.
Dagegen fällt viel anderes deutlich ab. »Scharping steigt vom Rad« als Signal dafür, dass der frühere Politiker sich vom Präsidentenamt des Bundes Deutscher Radfahrer zurückzieht – ein bisschen müde. Wenn schon Sprachklischee, liebe Freunde, dann bitte etwas saftiger. Dummerweise haben die Kolleg(inn)en von der FAZ versäumt, die Radmetapher wieder aufzunehmen, als Scharping dann doch als BDR-Präsident bestätigt wurde. »Scharping wieder fest im Sattel« wäre aber das Mindeste gewesen, was sie ihrem Stil schuldig sind.
Anlass zu verhaltener Freude gab aber dann wieder die Wirtschaftsredaktion nämlicher Zeitung, die mit der Zeile »Fabriksterben grassiert in der Autoindustrie« genau das Maß an Irritation auslöste, das der Leser so gerade noch ertragen kann. Das Sterben grassiert? Wirklich eine hübsche Vorstellung, dass das Sterben um sich greift. Sofern überhaupt eine Vorstellung damit verbunden sein sollte. Freilich kann es auch sein, dass der gemeine Zeitungleser genauso über Schlagzeilen wegliest, wie Zeitungschreiber und Überschriftenmacher ihre Zeitungen und Überschriften wegproduzieren.
Wohingegen die epd-Kollegen sich richtig etwas gedacht haben müssen bei der Zeile »An Babyklappen wird nicht gerüttelt«. Denn was macht man mit Klappen? Man klappt sie auf und zu. Oder rüttelt an ihnen. Schließlich soll der Journalist, auch wenn er lyrisch wird, nicht zu grob in die Phantasie seiner Leser, Hörer, Zuschauer greifen. Die könnten sich daran gewöhnen.
Zum Beispiel an die Meisterleistung der Süddeutschen Zeitung, die versuchte, den Besuch des früheren Fußballtrainers Otto Rehhagel in Griechenland als Botschafter des guten Willens im Dienste ihrer Majestät, der Kanzlerin, in Worte zu fassen. »Wie ein Fettauge auf antideutscher Suppe schwimmt die Delegation durch die Stadt.« Das wird so schnell nicht zu schlagen sein.
»Die Sprache ist eine Waffe. Haltet sie scharf!«, meinte Kurt Tucholsky. Ja, gut. Aber was soll man machen, wenn die Damen und Herren Kollegen den Dienst an der Waffe verweigern?
 Peter Zudeick ist freier Journalist, Autor mehrerer Sachbücher und arbeitet als politischer Korrespondent für mehrere ARD-Anstalten. Seine Spezialität ist der satirische Wochenrückblick.
Peter Zudeick ist freier Journalist, Autor mehrerer Sachbücher und arbeitet als politischer Korrespondent für mehrere ARD-Anstalten. Seine Spezialität ist der satirische Wochenrückblick.